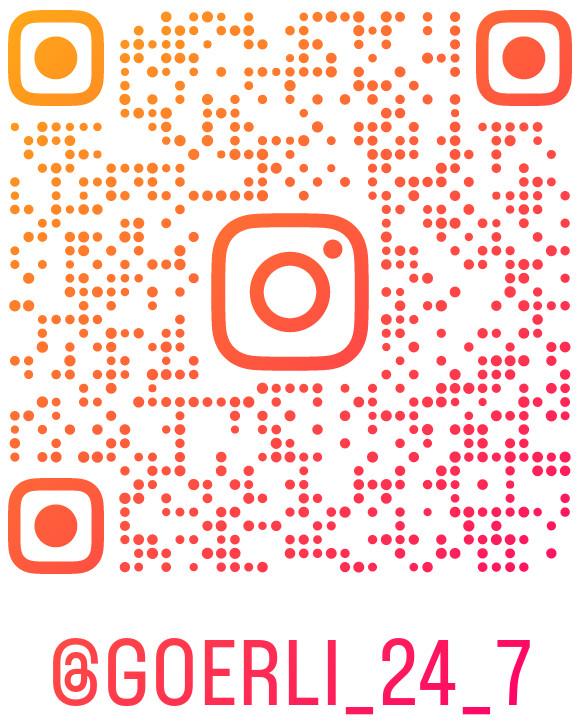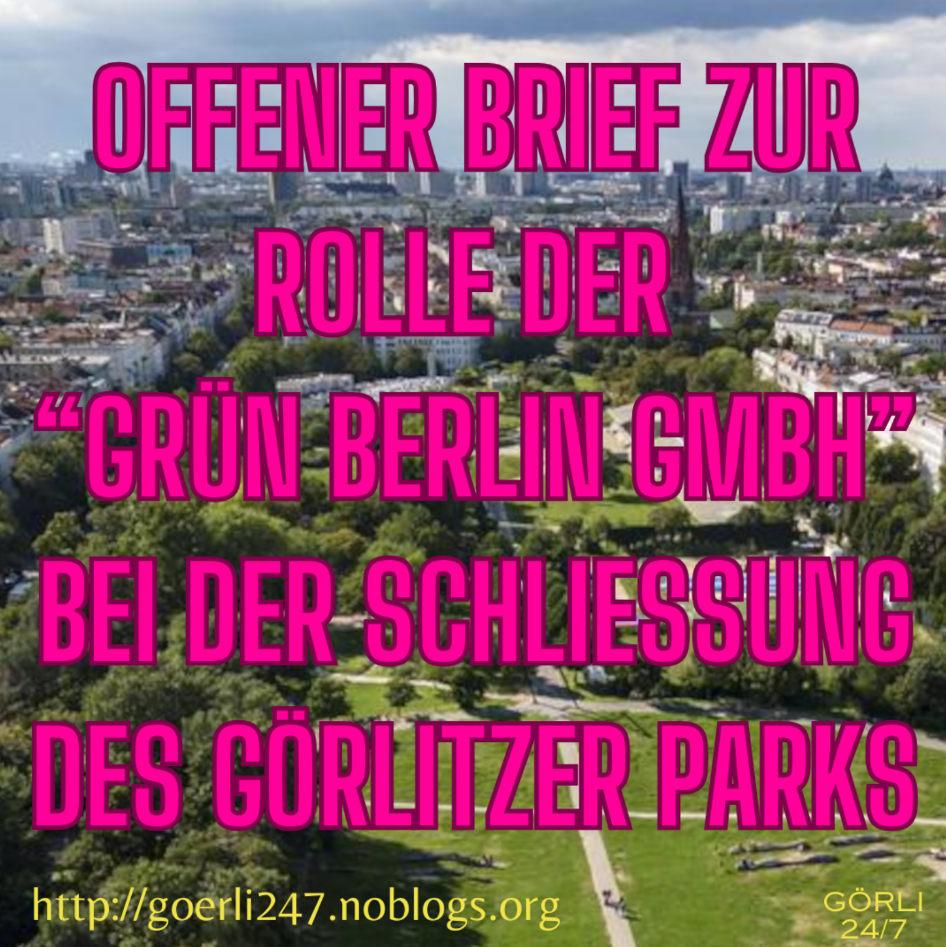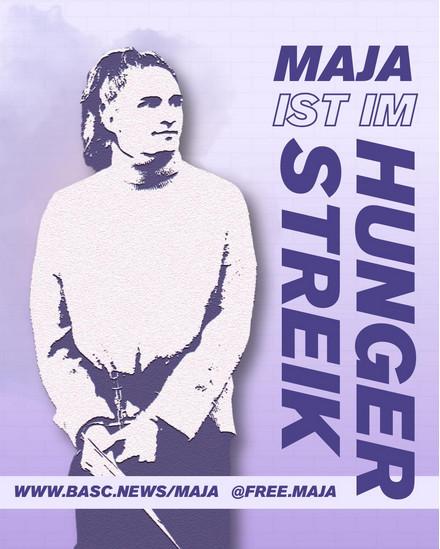// Der folgende Text wurde uns zugesandt. //
Anwohnerhaltungsjournalismus
Deutschlandfunk Kultur blamiert sich mit einer Sendung über den Görli-Konflikt
Ein Gastbeitrag von Ralf Hutter
Deutschlandfunk Kultur hat am 20.5. ein fast ganzstündiges Feature über den Görli-Zaunstreit gesendet. Leider ist der Beitrag nicht nur an mehreren Stellen misslungen, sondern schon von seinem grundsätzlichen Ansatz her. Er verzichtet an mehreren Punkten auf Recherche und setzt stattdessen auf die Subjektivität des Autors.
Das hat nicht nur das Bündnis Görli Zaunfrei mit mehreren Hinweisen kritisiert. Sogar die Süddeutsche Zeitung merkte in einem Kommentar an, dass diese Herangehensweise falsch ist.
Autor ist Lorenz Rollhäuser, ein 1953 geborener Journalist, der seit den 1990ern in Kreuzberg lebt. Er hat sich als direkter Anwohner lange um ein gutes Miteinander im Görli bemüht, sagt er selbst in seiner Sendung. Dem Sender war das von vornherein bekannt. Nicht nur hatte der Autor schon 2014 ein Feature über das Leben im gentrifizierten Wrangelkiez gemacht, das 2021 und im vergangenen Mai wieder ausgestrahlt wurde, sondern er bringt in der neuen Sendung O-Töne von internen Diskussionen der Nachbarschaftsinitiative, bei der er jahrelang mitmachte, und erzählt minutenlang von angeblichen Erfolgen dieser Gruppe. So etwas könnten in dieser Gegend etliche andere Leute ebenfalls machen, die haben aber keinen Zugang zu einem großen Radiosender. Rollhäuser wirft auch mehrmals Fragen als „wir“ auf, die ganze Recherche ist also klar die einer in den Berichtsgegenstand involvierten Person.
Mehr noch: Die ganze Sendung ist grundsätzlich von einer wertenden Haltung dieser involvierten Person geprägt, und zwar nicht von einer grundsätzlichen Wertung als Ausgangsposition, sondern von der Haltung, dass der Autor alles und jeden kommentieren darf. Die in der Anmoderation genannte Haltung, dass der Autor einen Park zum Verweilen und ohne Spritzen im Sandkasten will, ist nicht der Rede wert, denn das wollen so ziemlich alle Menschen. In der Anmoderation wird dann aber behauptet, diese „Selbstverständlichkeit“ sei in Kreuzberg keine, denn „da ist alles nicht so einfach“.
Rollhäuser sorgt zu Beginn immerhin für ein bisschen Transparenz, indem er sagt, welche Formen der politischen Auseinandersetzung ihm nicht gefallen („das Rausschreien von Hass und Wut“), und indem er den Glaubenssatz äußert: „Wenn wir im Park überhaupt etwas stemmen wollen, dann nur zusammen mit Bezirk und Senat.“ Ohne auf die Triftigkeit dieser Ansicht einzugehen – im Nachhinein zeigt sich, dass er in seinem Bericht den Senat nur wenig, ziviligesellschaftliche Akteure aber viel kritisiert, und das, obwohl er ebenfalls schon zu Beginn Missfallen darüber äußert, dass der Regierende Bürgermeister Wegner über die Köpfe der örtlichen Bevölkerung hinweg einen Zaun errichten lassen will. Wegner zeigt also nicht die Kooperativität, die Rollhäuser vorschwebt, wird aber sonst kaum mehr erwähnt.
Subjektiviät als journalistisches Mittel
Dieser Ansatz für so ein Feature ist falsch. Es gibt verschiedene Gründe, warum eine so große Sendung offen aus einer subjektiven Perspektive heraus gestaltet werden kann. Zum Beispiel hat mal eine Journalistin ganz klischeehaft alte Unterlagen ihres schon lange toten Großvaters gefunden, festgestellt, dass er an historisch interessanten Dingen beteiligt war, und daraus ein Radiofeature gemacht, in das sie auch Stimmen aus der Familie sowie eigene Gefühle einbrachte. Das kann gut funktionieren. Rollhäuser hat selbst mal einen Preis für ein Feature bekommen, in dem er davon berichtet, wie er sein Elternhaus ausräumt. Es kann auch gut funktionieren, dass jemand mit einer seltenen oder zu wenig beachteten Krankheit aus der Ich-Perspektive so eine große Sendung über diese Krankheit macht. Oder jemand, der sich an Orten aufhält, wo die große Mehrheit seines Publikums noch nie war, und dann berichtet, wie sich das anfühlt.
Alles das ist hier überhaupt nicht gegeben, im Gegenteil. Es geht hier um einen Park, um einen der öffentlichsten und damit unpersönlichsten Räume überhaupt. Dieser Park wird sogar stark von einem diversen Publikum frequentiert. Mehr noch: Er ist berühmt, politisch umkämpft und mit verschiedenen Problemen beladen, über die sich manchmal auch Medien außerhalb Berlins den Mund zerreißen. Es gibt also sehr viel zusammenzutragen, viele Themen, viele Stimmen, und das nicht nur aus der Gegenwart, sondern es könnte auch um Historisches gehen. Dabei ist niemand eine privilegierte Quelle, höchstens für einzelne Aspekte. Subjektivität als leitendes Prinzip ist hier also fehl am Platz. Ein Journalist kann für sich dabei eine herausgehobene Stellung – negativ ausgedrückt: Besserwisserei – beanspruchen, wenn er viel recherchiert hat und deshalb viele Gegenargumente oder -darstellungen hat, wenn ihm lokale Akteure etwas erzählen. Das muss er sich aber erarbeiten, und er muss dabei immer argumentieren und seine Gedankengänge transparent machen, nicht seine bloße Meinung äußern. Was Deutschlandfunk Kultur stattdessen gemacht hat, ist: von den vielen Leuten, die sich in den letzten Jahrzehnten für den Görli engagiert haben, einen zu nehmen und ihm zuzugestehen, dass er das Geschehen im Görli und den politischen Streit um den Görli super bewerten kann und deshalb eine fast ganzstündige Sendung aufbauend auf seinen Meinungen machen darf.
Klar, der Autor musste für die Sendung mit vielen Leuten sprechen. Die guten Passagen des Features sind die, wo – zum Teil relativ lange – Leute von der Straße zu Wort kommen, auch mit unschönen Worten. Aber Hintergrundrecherchen wurden nicht verlangt – als ob es bei den Motiven einer Landesregierung, die die Regulierung eines Parks, für den der Bezirk zuständig ist, an sich reißt, oder bei den dabei angeführten Kriminalitätsstatistiken nichts zu hinterfragen gäbe. Auch die interessanten allgemeineren juristischen Aspekte der „Verpolizeilichung des Grünanlagenrechts“ (bei der es auch schon mal um „das Wegbier als Berliner Institution des Feierabends“ ging) kommen überhaupt nicht vor.
Irre Ansichten und Vorschläge statt Analysen
So füllt Rollhäuser seine Darstellung mit einem Haufen dummem Zeug. Statt eine Analyse der politischen Streitigkeiten zu liefern, behauptet er: „Es ist das alte Berliner Ping-Pong-Spiel, das alle so satt haben: Bezirk und Senat schieben sich gegenseitig die Verantwortung für die Lage zu.“ Er konfrontiert dann die Bezirksbürgermeisterin mit diesem Vorwurf, woraufhin die entgegnet, dass in den Kiezen um den Görli mehr Polizei (mit lokalen Kenntnissen) erwünscht sei und sie das der Innensenatorin mitgeteilt habe, die habe das aber ignoriert. Rollhäusers Umgang damit: „Ein Brief und keine Antwort – was will man da schon machen? Aber Sarkasmus hilft uns auch nicht.“ Sondern, was hilft uns denn dann? Das könnte ein besserwisserischer Journalist ja jetzt erläutern. Aber er tut es nicht. Dabei merkt er selbst an, dass die Polizei „sich nicht in die Karten gucken“ lassen will und ihm ein Interview verweigert hat. Auch hier ist also wieder sein Glaubensgrundsatz verletzt: Der Senat will nicht auf die Bezirksbürgermeisterin und einen Teil der örtlichen Bevölkerung hören, sondern macht sein eigenes Zaun-Ding – aber Kritik dafür erhält er von Rollhäuser kaum.
Stattdessen greift der Autor in den letzten zehn Minuten der Sendung immer wieder den von ihm ungeliebten Teil der Zivilgesellschaft an. Gegen Mauern und Zäune zu sein, sei „eine Politik der einfachen Bilder, mit der sich prima Stimmung machen lässt“, dabei wolle der Senat doch nicht „die Enteignung oder Zerstörung des Parks“. Stimmt. Er will Mauern und Zäune, denn mit dieser Politik der einfachen Bilder lässt sich prima Stimmung machen.
Rollhäuser verteidigt das ohne Argumente: „Kann es nicht auch sein, dass durch die nachts verschlossenen Tore ein starker Magnet entfällt, der die Drogenszene überhaupt erst in die Gegend zieht? (…) Solange es nicht ausprobiert wird, bleibt alles Spekulation.“ Nach dieser Logik könnten wir es auch damit probieren, alle Obdachlosen, Drogenabhängigen und Drogendealer ins Gefängnis zu sperren. Und alle Ausländer abzuschieben, was übrigens auch sehr heilsam für den Wohnungsmarkt wäre. Solange wir das nicht tun, bleibt es Spekulation, ob es hilfreich ist.
Aber unabhängig davon erschließt sich mir nicht, warum ein nächtlicher Magnet ein Problem sein soll, der tagsüber weiter Magnet sein darf. Wer nachts im Görli Angst hat, kann ihn auch jetzt schon meiden, dafür braucht es keinen Zaun. Es geht dem Senat ja nicht darum, gefährliche Menschen nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Görli zu entfernen und den Park so sicherer zu machen, sondern gar niemand soll dann im Park sein. Mir ist nicht ersichtlich, was das vor Einbruch der Dunkelheit bringen soll. Da kann der Görli weiterhin dieser Magnet sein.
Die Linke ist schuld
Kritik an diesem Unsinn tut Rollhäuser als „alten Kreuzberger Empörungsreflex“ ab, als „Kreuzberger Spiel vom widerborstigen gallischen Dorf“. Kreuzberg ist also nicht mit Argumenten dagegen, sondern aus Prinzip. Einen Ausdruck dieses Prinzips fasst der Autor so zusammen: „Ängste und Gewalterfahrungen, die den Park für viele zur No-go-Area machen, werden von der Linken regelmäßig relativiert oder gleich ganz geleugnet.“
Diese pauschale Ausdrucksweise ist sehr peinlich für jemanden, der seit rund 30 Jahren am Görli wohnt. Er klingt wie ein Journalist einer süddeutschen Lokalzeitung in einem Dorf, in dem es nur zehn Linke gibt. Oder als sei er von dieser Dorfzeitung nach Berlin geschickt worden, um über lokalpolitische Auseinandersetzungen in Kreuzberg zu berichten. Es ist schwachsinnig, so von „der Linken“ zu schwadronieren. Es gibt alte und junge Linke, wohlhabende und arme, kräftige und schmächtige, ängstlichere und weniger ängstliche; Linke verschiedener Geschlechter; Linke, die morgens im Park joggen, und Linke, die nachts noch dort abhängen; Linke, die Drogen nehmen, und Linke, die das grundsätzlich ablehnen. Wer ist also gemeint?
Nicht wenige Linke nehmen an Wahlen teil, und die allermeisten wählen dann wohl die Linkspartei. Als Rollhäuser wahrscheinlich gerade in der Endphase seiner Recherche war, fand am 23. Februar die Bundestagswahl statt. Im Wahlkreis, zu dem Kreuzberg gehört, holte erstmals die Linke das Direktmandat (34,7% der gültigen Stimmen) und auch die meisten Zweitstimmen (31,7%). Das Ergebnis ist online für jedes Wahllokal dokumentiert. In den Wahllokalen für die Görlitzer und die Wiener Straße kam die Linkspartei je nach Erst- und Zweitstimme auf zwischen 37 und über 50 Prozent, wobei es im Durchschnitt deutlich über 40 Prozent waren. So undifferenziert, wie Rollhäuser sich ausdrückt, legt er sich also mit geschätzt der Hälfte der wählenden Bevölkerung in der Umgebung des Görli an, denn auch andere Parteien werden von Linken gewählt.
Dass „die Linke“ die Geschehnisse im Görli nicht nur, wie Rollhäuser es darstellt, besserwisserisch und ignorant kommentiert, sondern auch mal mittendrin ist, zeigt der Fall eines halbwegs prominenten Linken, der selbst im Görli zum Gewaltopfer wurde: Raul Zelik, langjähriger antikapitalistischer Publizist und Politikwissenschaftler, ab 2012 Mitglied der Linkspartei (ob heute noch immer, weiß ich nicht) und mittlerweile Redakteur der sozialistischen Zeitung ND (Neues Deutschland). 2013 wurde er nachts im Görli übelst verletzt, worüber nicht nur er selbst berichtete. Der Journalist und Szene-Kenner Peter Nowak schrieb in der Folge: „Nachdem der Schriftsteller an die Öffentlichkeit gegangen war, outeten sich auch andere Linke als Opfer von Überfällen.“ Überfälle im Görli, wohlgemerkt.
Der folgende Satz in Rollhäusers Sendung lautet aber: „Genau diese Weigerung, die Lage vor Ort wirklich ernst zu nehmen, hat dem Senat die Tür dafür geöffnet, die alte Idee mit der nächtlichen Schließung wieder auszugraben.“ Das ist eine so unterirdische Politikanalyse, dass es schon fast nicht mehr kurios zu nennen ist. Jemandem die Tür für etwas zu öffnen bedeutet, ihm etwas zu ermöglichen, eventuell auch, ihn dazu anzureizen, einzuladen. Rollhäuser behauptet: Wenn „die Linke“ die Lage ernst genommen hätte, hätte Wegner nicht den Zaun durchgesetzt. Der Regierende hätte dann also gesagt: Gut, dass die Kreuzberger Linke die Probleme im Görli ernst nimmt und nach Lösungen sucht, dann brauch ich mich nicht zu kümmern – ich hab ja auch grad überhaupt keinen Fuß in der Tür, um da irgendwas zu erreichen.
Aber woran zeigt es sich, dass jemand die Probleme im Görli ernst nimmt? Zum Beispiel an den Flugblättern und Plakaten, die seit langem zwar den Senat kritisieren, aber auch Dauerprobleme im Görli benennen und deren Behebung durch Hilfsmittel statt Repression fordern. Lorenz Rollhäuser reicht das offenbar nicht. Vielleicht schwebt ihm der Aufbau einer linken Kiezmiliz vor, die anstelle der Polizei die Lage beruhigt – dann verscherzt er es sich aber mit seiner Sendung mit der dafür in Frage kommenden Klientel.
Unter anderem mit dem von ihm so bezeichneten „örtlichen Vollzeitanarchist“. Den interviewt er, ohne ihn ganz zu verstehen. Dessen Ausführungen schickt Rollhäuser voraus: „Der Streit um den Zaun ist Mittel zum Zweck beim Streit um das große Ganze.“ Aha, die Kreuzberger Linken stören sich gar nicht primär an Polizeischikanen und einer nächtlichen Schließung sowie Überwachung des Parks, sondern sie wollen den Konflikt anheizen, um eine Revolution anzuzetteln! Die Analyse geht weiter: „Wem es um Systemfragen geht, der hat an bescheidenen Verbesserungen im Kiez kein Interesse. Vielleicht werden sie sogar als kontraproduktiv abgetan, weil dadurch die wahren Verhältnisse verschleiert würden.“ Rollhäuser verkneift es sich, dann konsequent weiterzumutmaßen: Vielleicht sind es die Linken, die das Crack in den Görli liefern, unschuldige Schwarze bei der Polizei denunzieren, in Hauseingänge pinkeln und nach Einbruch der Dunkelheit Menschen ausrauben und belästigen. Klar, ohne Verelendung und andere Eskalationen gibt es keinen Systemsturz. Die Linken brauchen schlechte Zustände für ihren politischen Sieg. Auch die Linkspartei darf sich nicht nur auf die eher gut situierten Menschen mit Uni-Abschluss stützen, von denen sie in den letzten Jahren vermehrt Zuspruch erhält, sondern hat ein Interesse an Armut und Diskriminierung. Umgekehrt sind es gerade die Senatsparteien, die an Verbesserungen im Kiez interessiert sind, denn solche Verbesserungen stabilisieren das große Ganze, das sie erhalten wollen. So wird am Ende der Sendung verständlich, warum Rollhäuser den Senat nur kurz und oberflächlich kritisiert.
Der „Vollzeitanarchist“ erklärt es allerdings differenzierter: Ohne Lösung der vom Kapitalismus verursachten Probleme werde sich die Situation weder hier noch an anderen problematischen Orten Europas ändern. Also: Gerade weil wir die Situation im Kiez dauerhaft und nachhaltig verbessern wollen, müssen wir übergeordnete Probleme sinnvoll angehen (und nicht mit Zäunen in unseren Parks und verschärften Kontrollen an den Grenzen, oder gar mit einem permanenten Bruch der menschenrechtlichen Garantien aus Grundgesetz, EU-Grundrechtecharta, Europäischer Menschenrechtskonvention und UN-Flüchtlingskonvention). Eine von Rollhäuser interviewte Drogenabhängige berichtet, dass sie ihre Wohnung im Kiez wegen einer Eigenbedarfskündigung verlor und seitdem auf der Straße lebt, weil sie die Gegend nicht verlassen will. Eigenbedarfskündigungen sind in Berlin bekanntlich zu einem Problem immensen Ausmaßes geworden, vor allem in den einschlägigen beliebten Innenstadtgegenden. In dieser Sendung, die sich der Suche nach Problemlösungen in Bezug auf Obdachlosigkeit und Drogenkonsum widmet, kommt das nicht vor.
Ich-Erzählungen nehmen im Journalismus zu
So geht eine katastrophale Sendung zu Ende. Deutschlandfunk Kultur hat sich für ein hochinteressantes und hochpolitisches Thema einen Autor ausgesucht, der nicht nur kaum Ahnung von Politik hat, sondern auch nicht von den politischen Strukturen und Kampagnen in der Gegend, in der er seit Jahrzehnten wohnt. Das Format Feature erlaubt subjektive Elemente in so einer großen und damit umfassenden Sendung, aber es darf nicht ohne Hintergrundrecherchen und die Benennung politischer Interessen mächtiger Akteure auskommen.
Dass dieser falsche Ansatz keine Ausnahme ist, legt nicht nur der Konsum von Radiofeatures nahe, sondern auch eine kürzlich erschienene Studie der Otto-Brenner-Stiftung (das ist eine Stiftung der IG Metall zur Analyse und Förderung von Journalismus). Titel: „Ich-Erzähler*innen. Neue Reportage-Formate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk“.
Die Stiftung zitiert einen der Autoren mit den Worten: „Die neuen öffentlich-rechtlichen Formate setzen noch konsequenter als ihre Vorgänger auf die Ich-Perspektive der Reporter*innen. Nahezu jedes Thema wird über ihre persönlichen Erwartungen, Erfahrungen, Eindrücke oder Emotionen präsentiert. Durch diese Personalisierung stehen die Reporter*innen regelmäßig im Fokus der Erzählung.“ Das führt zu Defiziten, wie die Stiftung zusammenfasst: „Investigative Recherchen und andere Quellen sind hingegen kaum erkennbar, wissensorientierte oder erklärende Aufbereitungsstrategien kommen nur am Rande vor.“
Eine erklärende Aufbereitungsstrategie könnte darin bestehen, den Görli-Zaun in eine Reihe mit anderen symbolpolitischen Maßnahmen und Kampagnen der CDU der jüngsten Vergangenheit zu stellen: die rechtswidrigen Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze, die verlogene Kampagne gegen Bürgergeldbeziehende und die seit zwei Jahren durchgeführten Ausweiskontrollen an den Einlässen von Berlins Freibädern.
Haltungsjournalismus darf kein Schimpfwort sein, das explizite Äußern von Haltung kann in der einen oder anderen Form gerechtfertigt sein. Aber es darf bei der Behandlung eines großen Themas nicht alles sein. Der Streit um den Görli leidet nun unter diesem Fall von Anwohnerhaltungsjournalismus, bei dem ein an einem vielschichtigen Konflikt beteiligter Mensch unfundierte Ansichten ausbreiten darf und dafür aus Zwangsgebühren über 4000 Euro erhält. Diese Sendung ist nicht nur eine verpasste Chance für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, sondern Anlass zu großer Kritik und Sorge bezüglich des intellektuellen Niveaus in einem von der Allgemeinheit finanzierten und der Allgemeinheit verpflichteten Sender.
Ralf Hutter ist Freier Journalist und hat in den letzten 15 Jahren auch für über ein Dutzend Redaktionen von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur gearbeitet